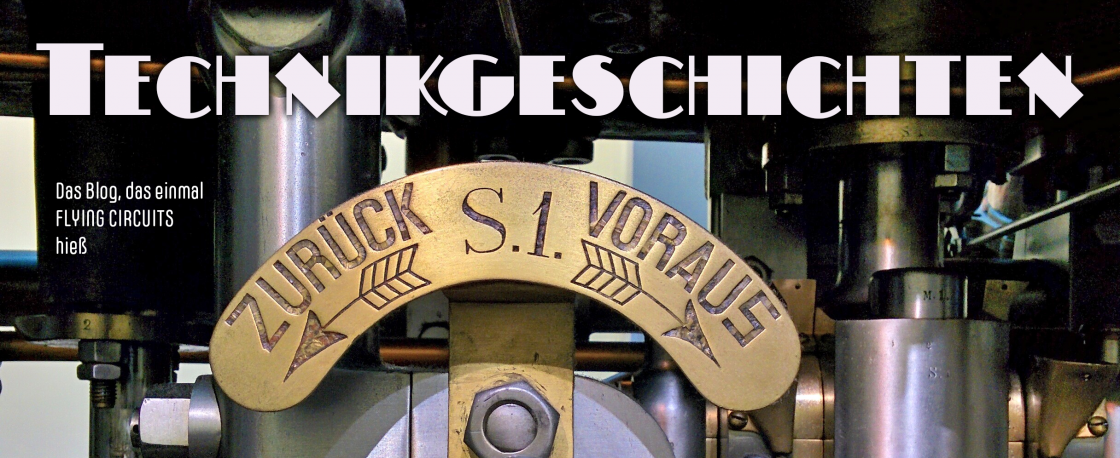Manchmal schlägt das Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Mittagspause seltsame Wege ein. So redeten wir kürzlich über Berlin und meine Gedanken rutschten unversehens zurück in die frühen 90er Jahre. Damals war ich spätestens alle paar Monate in Berlin – ich kannte dort Leute und wollte so oft wie möglich raus aus der badischen Provinz, wo ich meinen Zivi leistete, und hinein in die große Stadt. Und obwohl ich fast zwanzig Jahre nicht mehr daran gedacht hatte, fiel mir plötzlich wieder ein seltsamer Laden ein: die Blei Bar in der Fehrbelliner Straße (Hausnummer 6, wenn ich mich nicht irre).
Als Landei war ich offenbar so schwer von der Blei Bar beeindruckt, dass ich einen kleinen Text darüber schrieb. Weil das schon auf einem Computer passierte (der meinem Mitbewohner gehörte und auf dem übrigens noch kein Windows lief), entstand dieser Text bereits digital. So hat er sich in meinem von Rechner zu Rechner stets mitgezogenen Datenbestand bis heute erhalten:
„Die Blei Bar befand sich im Erdgeschoß eines ansonsten wohl leerstehenden Ziegelbaues aus der Gründerzeit, von dem – wie in diesem Viertel üblich – die Zementfassade gleich in Stücken von halben Quadratmetern abfiel. Alle Fenster waren verammelt, nur neben der abgestoßenen Haustüre glomm ein schwaches, zinnoberrotes Licht hinter einer blinden Opalglasscheibe, die mit kleinen eingeschliffenen Sternchen gemustert war. Auf die Scheibe hatte jemand kaum sichtbar und linkisch mit taubenblauem Lack aufgesprüht: Blei Bar. Aber das konnte man eigentlich erst lesen, wenn man schon wußte, was es heißen sollte.
Der Hausflur war stockdunkel, nach links führte ein schwach erleuchteter Gang ab, der an einer Tür endete. Schon hier war die Musik ohrenbetäubend. Denn hinter einem groben Mauerdurchbruch links vor der Tür lag die Bar: ein vollkommen kahles Zimmer von vielleicht sechs Metern im Quadrat, das eine Theke aus Stahlblech, fünf Barhocker, ein Sperrmüllsofa und eine Musikanlage enthielt. Auf dem einen Ende der Theke stand eine weinflaschenhohe Glühbirne mit gewendelten schwarzen Plastikfuß, deren Glühfaden die Form eines Edelweiß hatte. Das andere Ende der Theke zierte eine dreidimensionale Uhr mit Zeigern aus bunten Plastikfäden und Flitterbüschen, von unten beleuchtet, das ganze unter einer Art pyramidenförmigen Plexiglassturz gefangen. Auf der Theke standen sonst noch ein paar Bierflaschen und ein Diaprojektor. Der warf ein gemaltes Bild an die Wand: Jemand (der vielleicht noch ein Kind war) hatte auf blaue Folie ein seltsames Tier mit Hörnern gekrakelt und daneben „Kuh“ geschrieben. Über dem Sofa war mit roter Farbe eine Spirale von etwa zwanzig Zentimetern Durchmesser auf die Wand gepinselt, als hätte die Wand voll werden sollen, aber die Lust hatte nicht dafür gereicht. Ansonsten gab es überhaupt nichts: Mehr Details berichten hieße Kippen und Kronenkorken auf dem Boden zählen.
Morgens um drei, als wir in die Blei Bar kamen, waren dort fünf Leute. Einer beschäftigte sich mit der Musikanlage, die in in Presslufthammerlautstärke pulsierte. Zwei standen an der Theke und spielten Domino. Einer hing am Fenster, hatte eine Postuniform an und hielt ein Weizenglas in der Hand. Am Diaprojektor fummelte ein blondes Mädchen in Kittelschürze herum, die eine blaue Sonnenbrille und eine hohe Ballonmütze aus rotem, steifen Filz trug.
Die Toilette lag auf der anderen Seite des Flures und hatte eine zwei Meter breite Holztür, die jeweils ein Schild „Damen“ und „Herren“ trug. Der Raum war größer als die Bar selbst, enthielt aber nur eine einzige Schüssel, die in eine Ecke geflohen zu sein schien. Es gab noch ein Waschbecken mit einem Spiegel darüber, an dem ein Strauß trockner Rosen hing. Das Ganze erhellte eine Glühbirne, die in zwei aneinandergeschraubten Trabi-Rücklichtern steckte.“
Heute bekommt man nicht mehr viel raus über die Blei Bar. Im Internet hat sie jedenfalls keine direkten Spuren hinterlassen, denn das Netz gab es 1993 eben noch nicht. Immerhin habe ich dort ein Foto gefunden. Es stammt von der Fotografin Eva Otaño Ugarte und es wurde offenbar 2010 in einer Ausstellung gezeigt. Da gab es das Internet schon, und deshalb ist das Bild auch hier zu sehen:

Wo auf dem Bild links vorne der Schaukelstuhl steht, befand sich in meiner Erinnerung (die sich vor allem auf den Text oben stützt) das Sofa. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich die Bar alleine nach dem Foto gar nicht wiedererkannt.
Eigentlich ist es Glück und Zufall, dass von der Blei Bar überhaupt ein Foto existiert. Damals hatte eigentlich niemand eine Kamera dabei. Man hatte auch kein Telefon dabei. In einem Club wie der Blei Bar konnten sich eigentlich alle sicher sein, weder angerufen noch fotografiert zu werden.
Keine Angst – es folgt hier jetzt kein Lamento, dass früher alles besser war, weil man damals ach so wilde Dinge tun konnte, ohne fürchten zu müssen, dass am nächsten Morgen das ganze Netz davon weiß. (So wild war das Leben damals auch nicht, jedenfalls meins nicht). Nein, im Gegenteil: Ich finde es schade, dass ich vor zwanzig Jahren eigentlich nie eine Kamera dabeihatte; es sei denn, ich zog vorsätzlich los, um Fotos zu machen.
Heute ist das anders – und ich finde es toll.
Alles, woran ich mich später erinnern möchte, kann ich jetzt mal eben schnell mit meinem Telefon fotografieren. Das sind heute nicht mehr so oft Szenen aus der Kneipe, immer öfter hingegen Poster, Plakate, Graffiti, Lichtsituationen. So fiel mir zum Beispiel neulich ein Plakat mit einem wunderschönen Hintergrundmotiv auf. Ich habe den Bildnachweis fotografiert, hatte dann den Namen des Künstlers, konnte den googeln und fand das Bild wieder: les mondes engloutis (= die verlorenen Welten) von Tom Haugomat:

Klar, im Prinzip wäre das auch früher gegangen, ich hätte mir vor zwanzig Jahren den Namen des Grafikers einfach aufschreiben können. Nur: Was hätte ich dann damit angefangen? Wie hätte ich jemals mehr über ihn herausfinden können, mehr Bilder von ihm zu Gesicht bekommen können, von einem Illustrator im fernen Paris, in den Zeiten vor dem Internet?
Ich kann mich daran erinnern, dass ich in der Blei-Bar-Zeit mal in einer Berliner Hinterhofgalerie-Ausstellung eine Radierung sah, ein Porträt, das mich sehr faszinierte. Es sollte zwar keine hundert Mark kosten, aber soviel Geld hatte ich damals nicht. Vielleicht habe ich mir sogar den Namen des Künstlers oder der Künstlerin irgendwo aufgeschrieben und den Zettel dann verlegt, später mal wiedergefunden, die Verbindung zum Bild nicht mehr hergestellt und ihn dann weggeworfen. Wie auch immer das war, mir bleibt nur die Erinnerung daran, dass ich mal ein solches Bild gesehen habe – die Erinnerung an das Bild selbst ist längst verblasst, genauso wie die Erinnerung an die Paraphrase darauf, die ich davon mal selbst gemalt und anschließend verschenkt habe…
Besser, ich schreibe solche Notizen heute gleich ins Internet. Denn es heißt ja immer: Das Internet vergisst nichts. Das könnte ja auch mal seine guten Seiten haben.